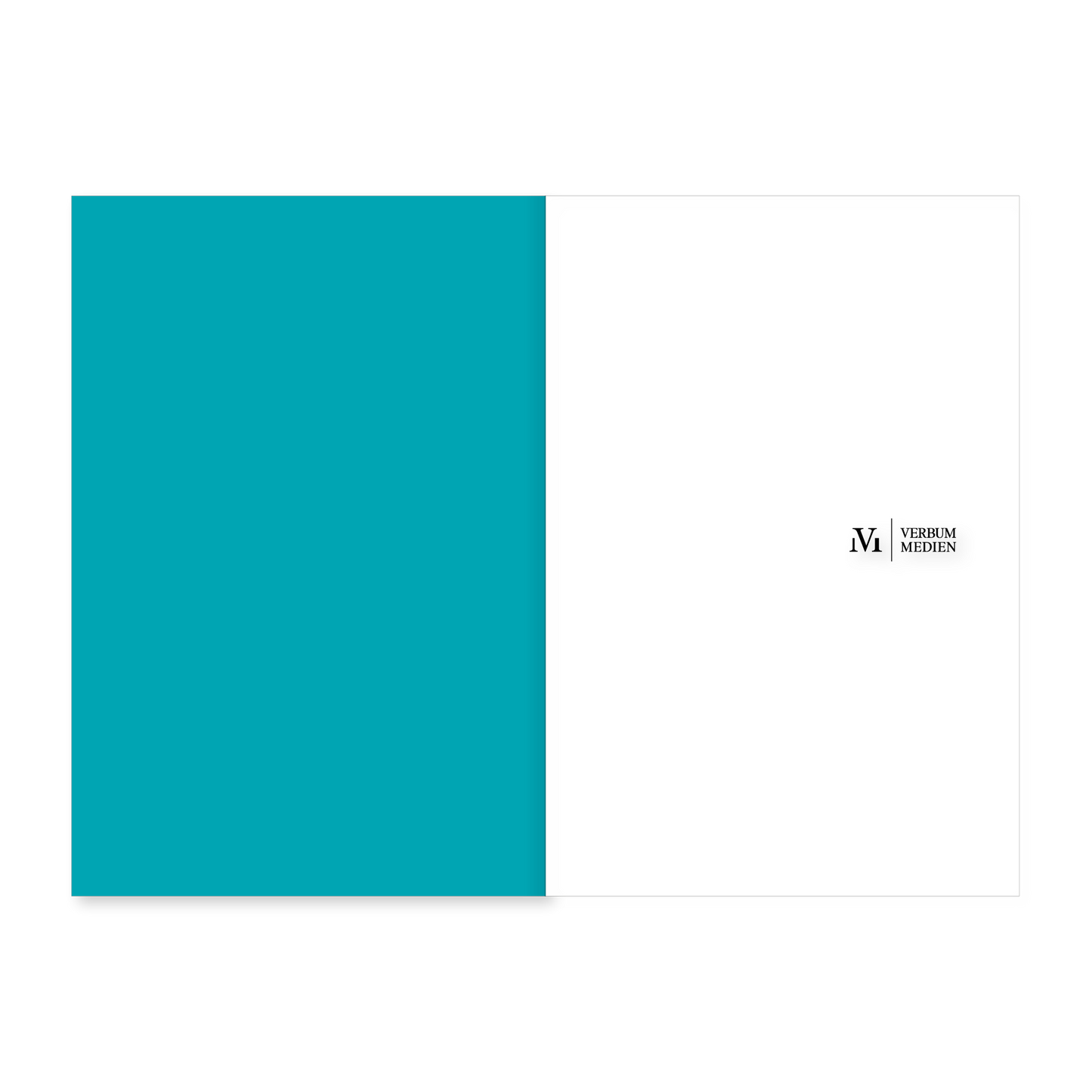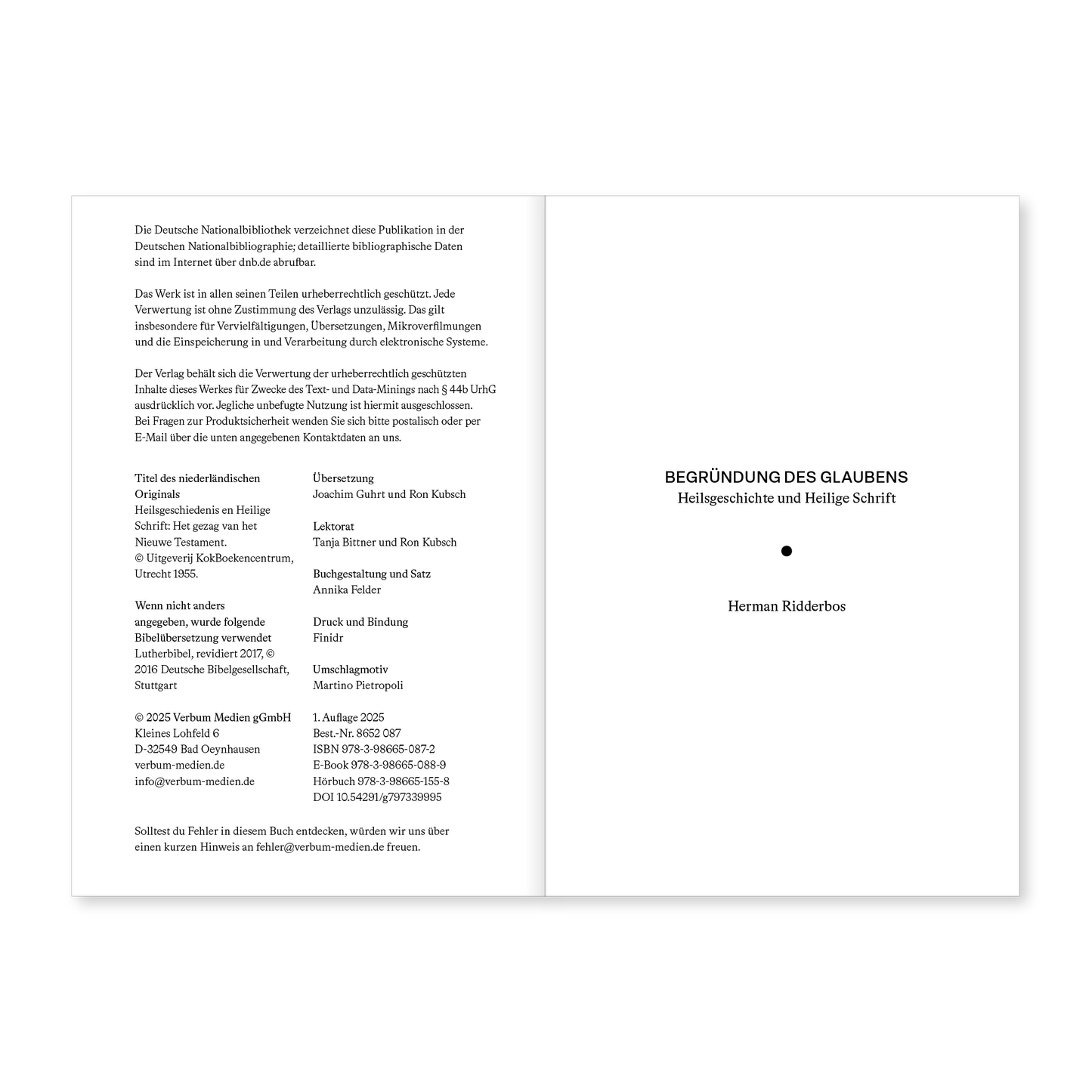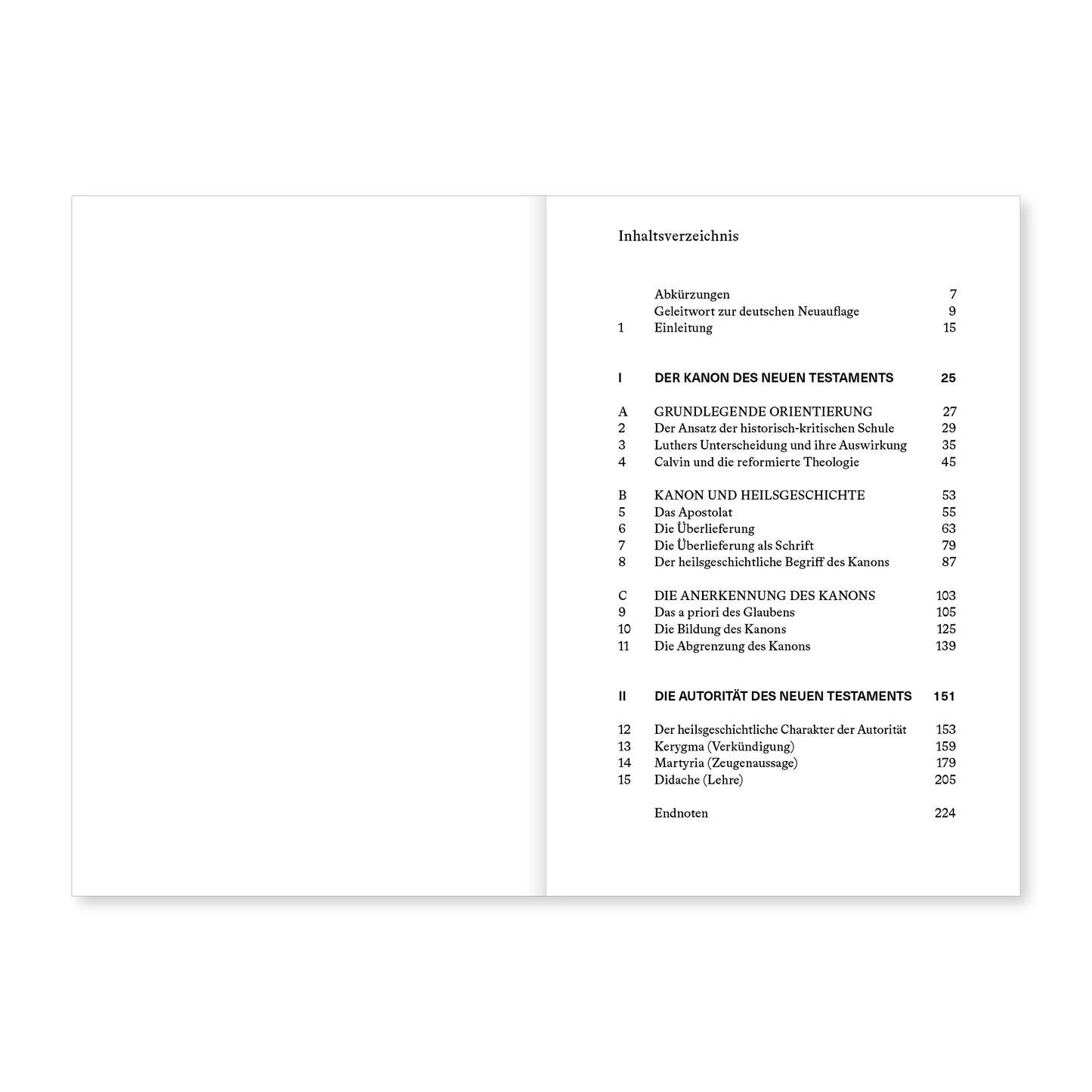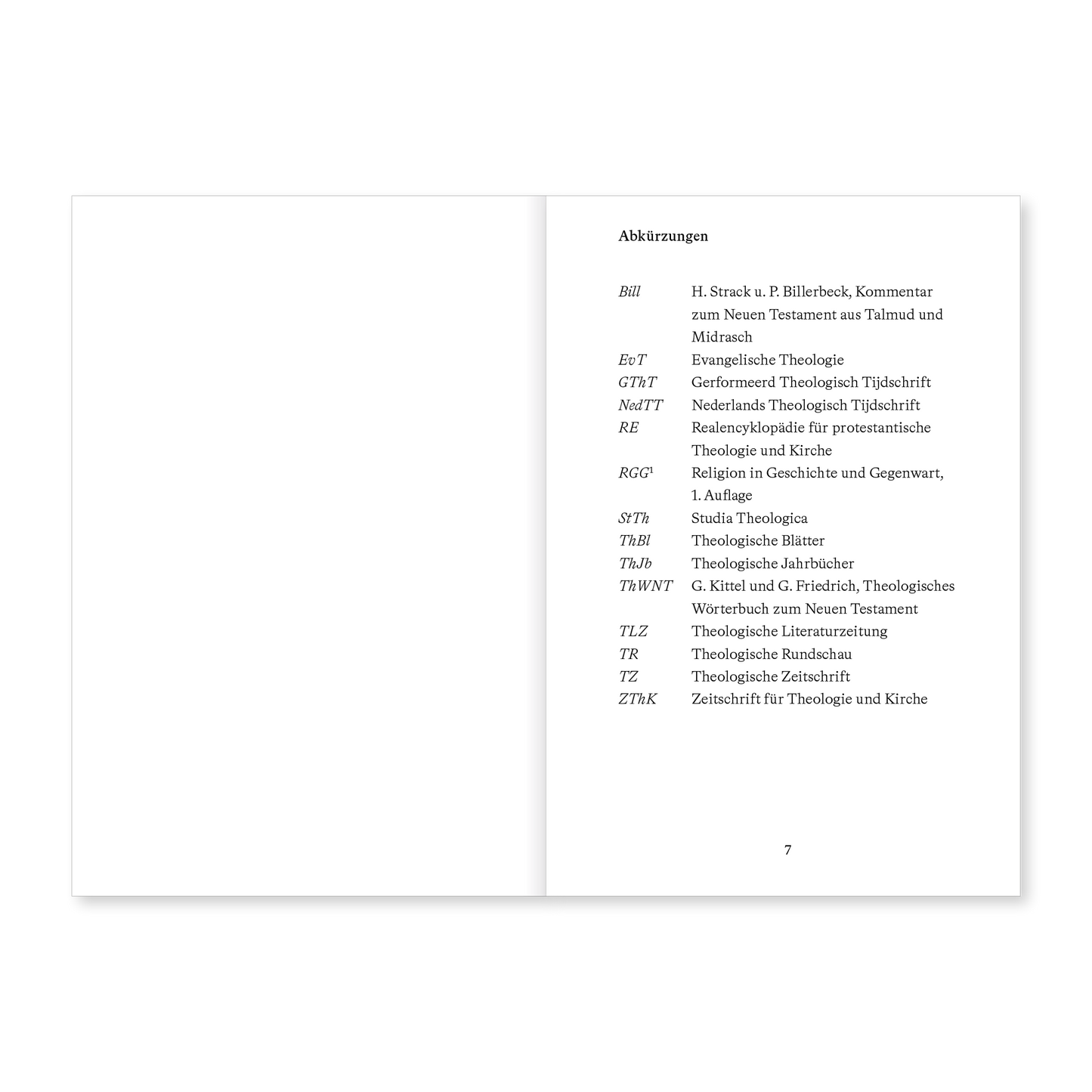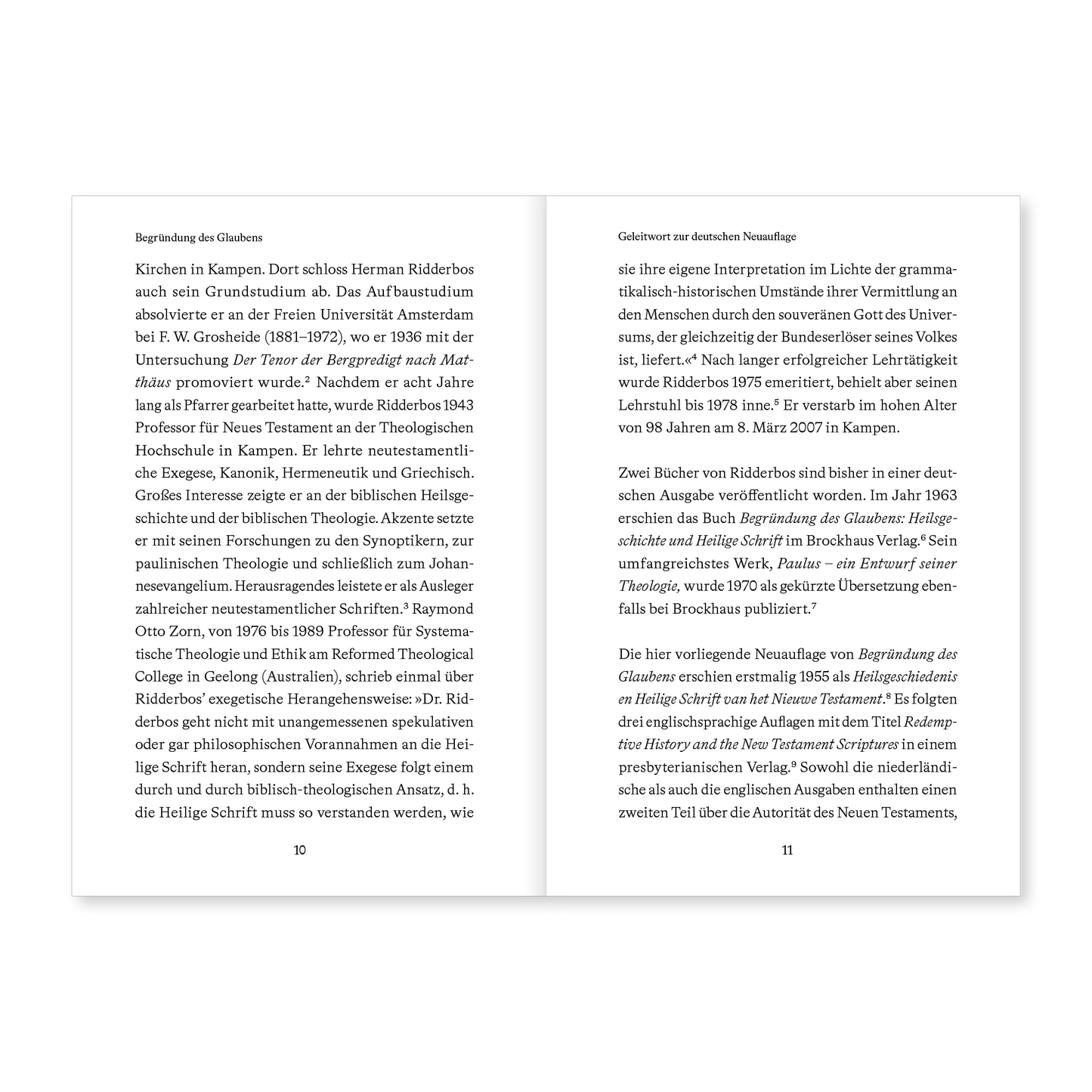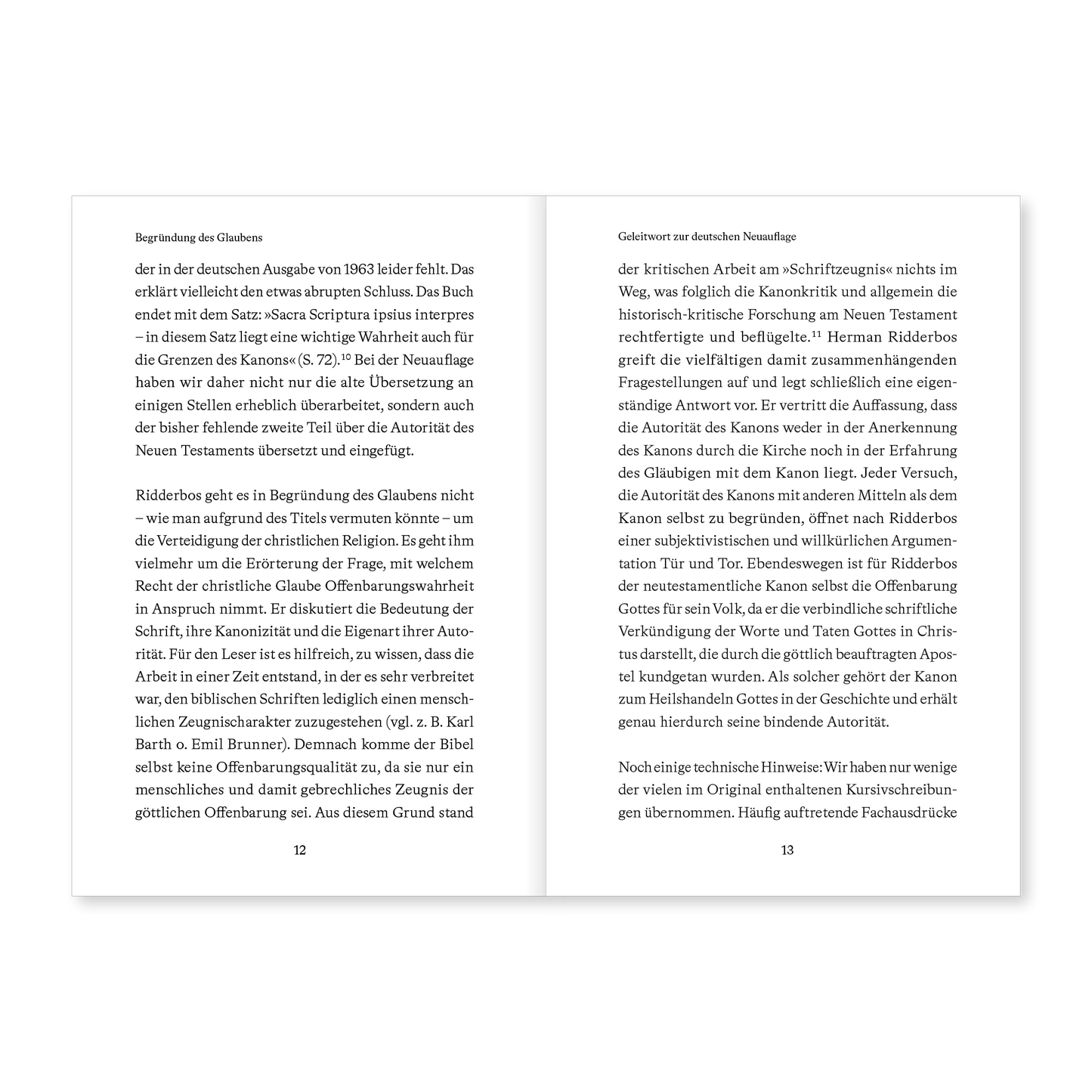Wie wurde festgelegt, welche Schriften Heilige Schrift sind und welche nicht? Seit dem Aufkommen der historischen Kritik beschäftigt die Kanonfrage Theologen und Laien.
Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit
Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit – diese Aussage meint nicht nur das Wort im Wort und nicht den Geist in der Schrift, sondern das Wort, wie es in der Gemeinde von den Aposteln und nach Maßgabe der Apostel verkündigt wurde (vgl. 1Petr 1,25). Es ist das zur Schrift gewordene Wort, das auf diese Weise seinen Lauf durch die Geschichte begonnen hat und zu Ende bringen wird. Auf dieses Wort und entsprechend diesem Kanon wird Christus seine Gemeinde gründen und bauen, indem die Gemeinde diesen Kanon annimmt und ihn durch das Zeugnis des Heiligen Geistes als Kanon von Jesus Christus anerkennt. Das ist nicht in dem Sinne zu verstehen, als könnte irgendeine Synode oder Kirchenversammlung, die in einem bestimmten Zeitalter weitreichende Beschlüsse bezüglich des Kanons gefasst hat, von sich selbst behaupten, in ganz besonderer Weise und ausschließlich diese Gemeinde zu sein oder zeitweilig Unfehlbarkeit besessen zu haben – oder als könnte man ihr solches nachträglich zuschreiben.
Kein kirchliches Amt, keine kirchliche Versammlung, von wie großer Bedeutung auch immer, kann für die ganze Kirche und ihre Zukunft als Garant des Kanons auftreten. Die Kirche bleibt, was die Annahme des Kanons betrifft, für alle Zeit an Christus gebunden und allein von Christus abhängig, gleichwie die Verheißung Christi für den Kanon sich auf die ganze kommende Kirche bezieht. Der Kanon des Christus wird also bestehen, weil es eine Kirche des Christus geben wird, und weil er durch seinen Geist auf diesen Kanon seine Gemeinde bauen wird. Dies ist die Glaubensvoraussetzung des neutestamentlichen Kanons. Es ist das a priori des Glaubens, das in der Einheit seiner menschlichen und göttlichen Person, seines irdischen und himmlischen Werkes begründet ist.
Dieses a priori enthebt uns nicht der Pflicht, der Geschichte des Kanons nachzugehen, und gibt uns auch nicht ohne weiteres das Recht, von dem Kanon des Christus auf den Kanon der Kirche zu schließen. Die Absolutheit des Kanons ist von der Relativität der Geschichte nicht einfach zu trennen. Wir werden aber die Kanongeschichte im Lichte des Glaubensapriori ins Auge fassen müssen, als eine Geschichte, in der sich nicht nur die Macht der Sünde und des menschlichen Irrtums auswirken, sondern vor allem auch die Verheißungen Christi, seine Gemeinde auf das Zeugnis der Apostel zu gründen und zu bauen. Nur in der Verbindung dieser beiden Gesichtspunkte, nämlich des heilsgeschichtlichen a priori, dass Christus einen Kanon als Fundament der Kirche gegeben hat, und der Kanongeschichte, dass die Kirche tatsächlich einen Kanon empfangen hat und darauf gebaut ist, scheint uns eine Möglichkeit gegeben zu sein, den Kanon in seiner konkreten Form hinreichend begründet als den Kanon des Christus anzuerkennen.