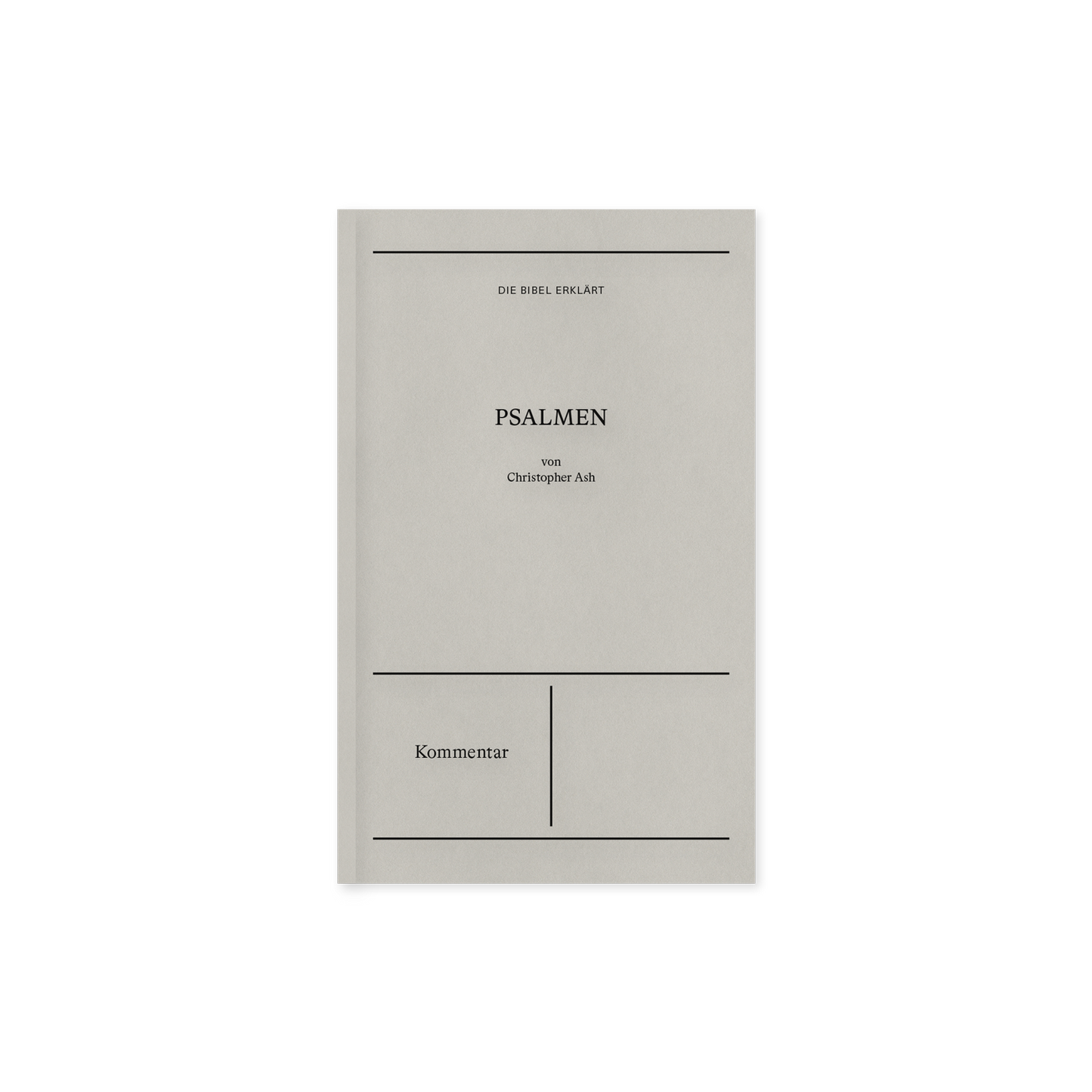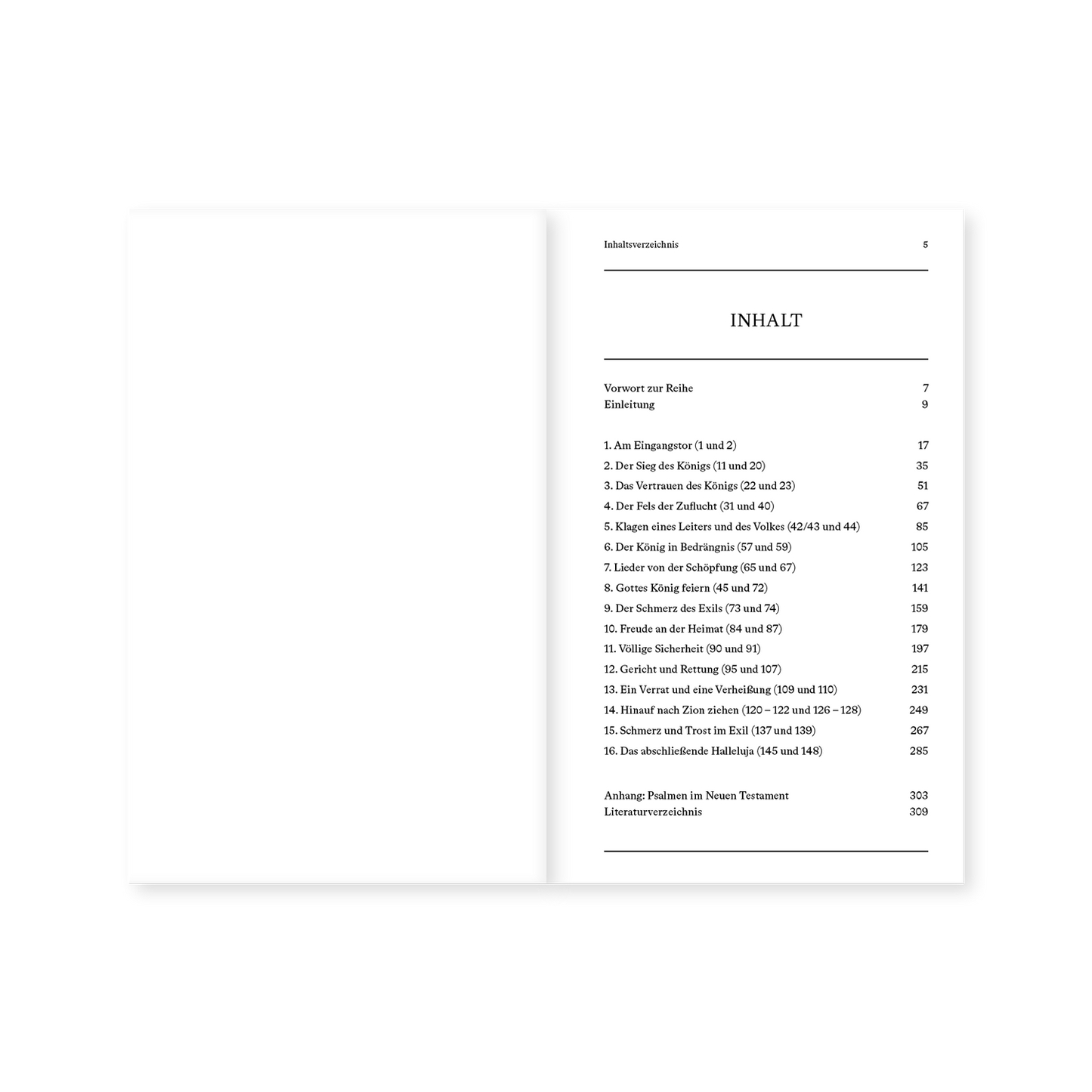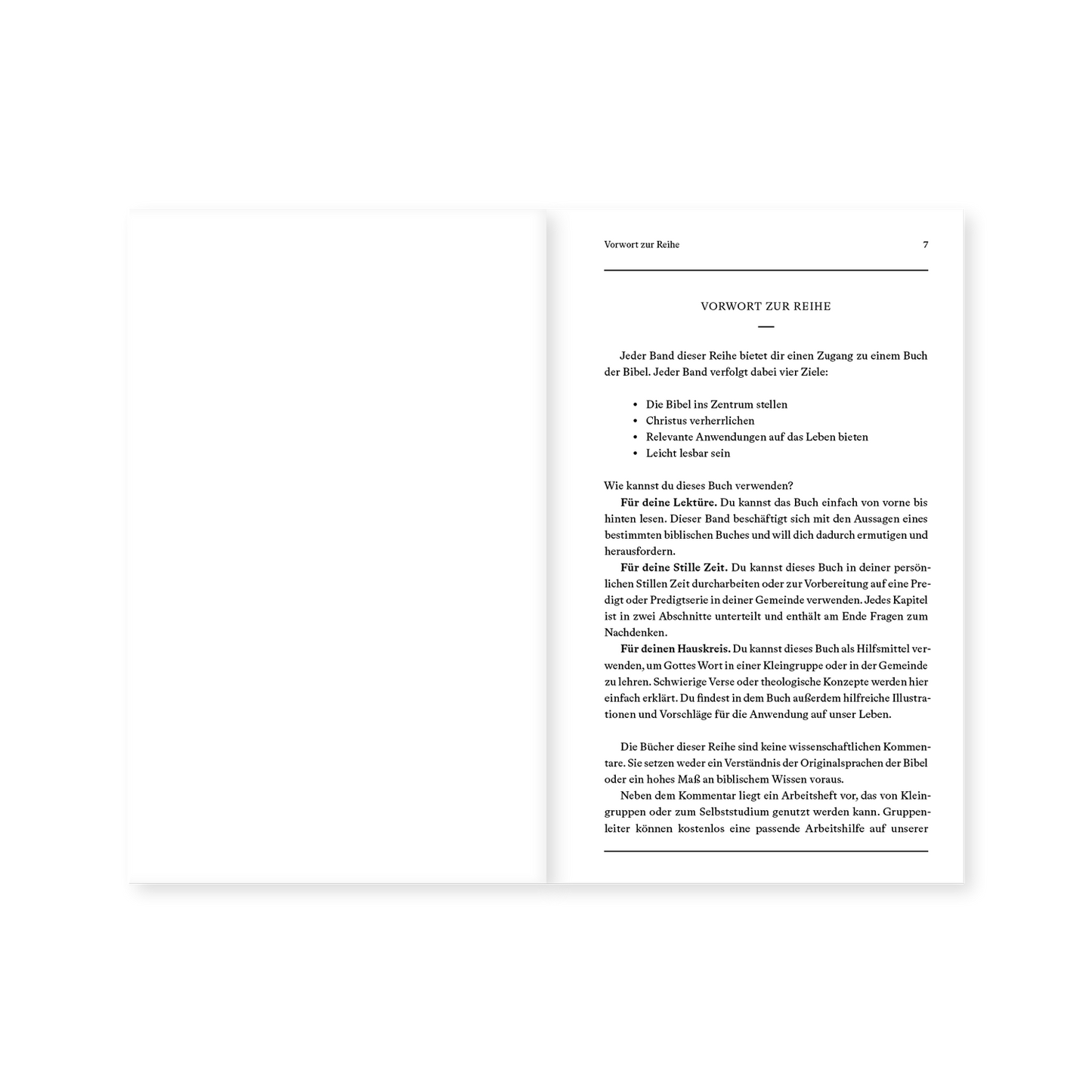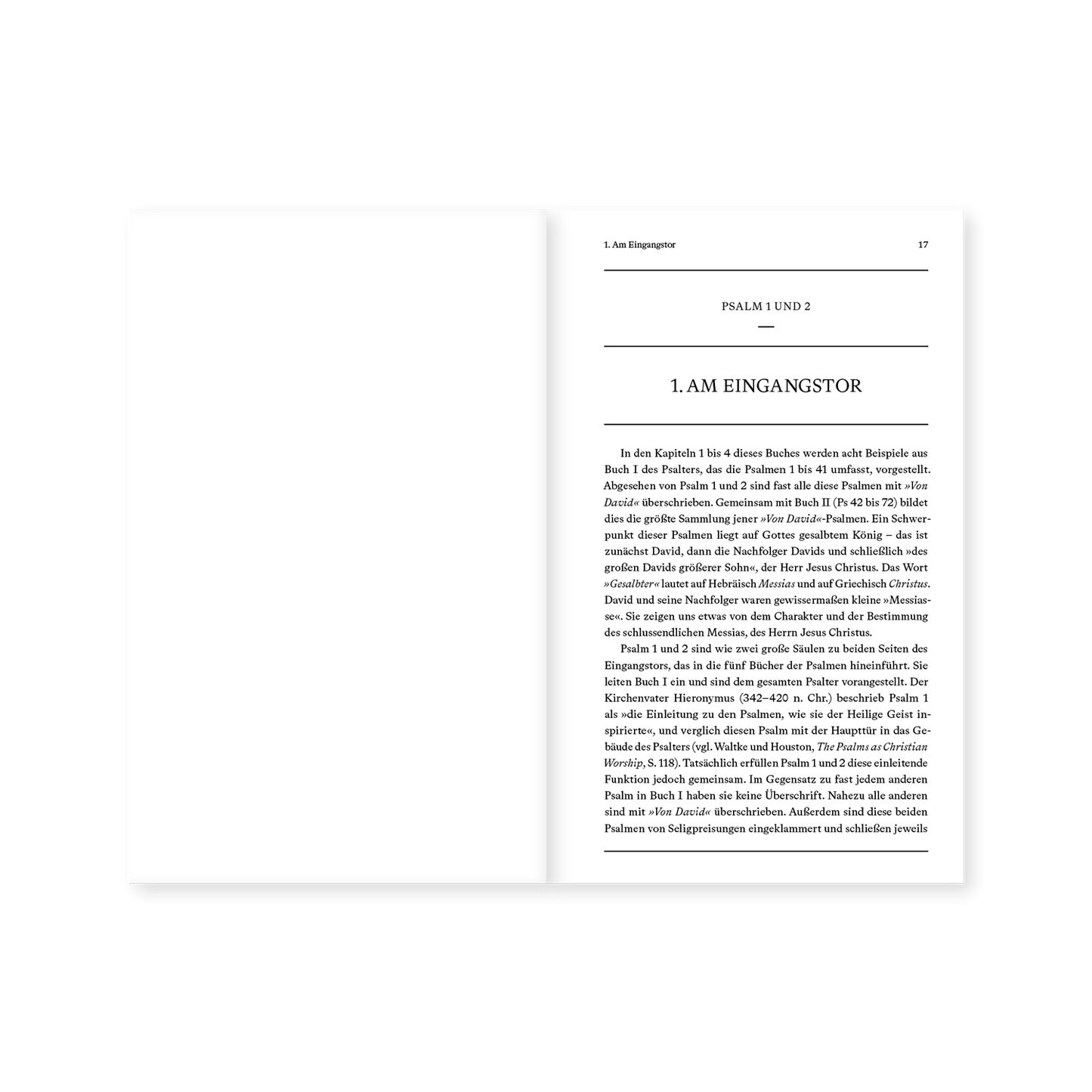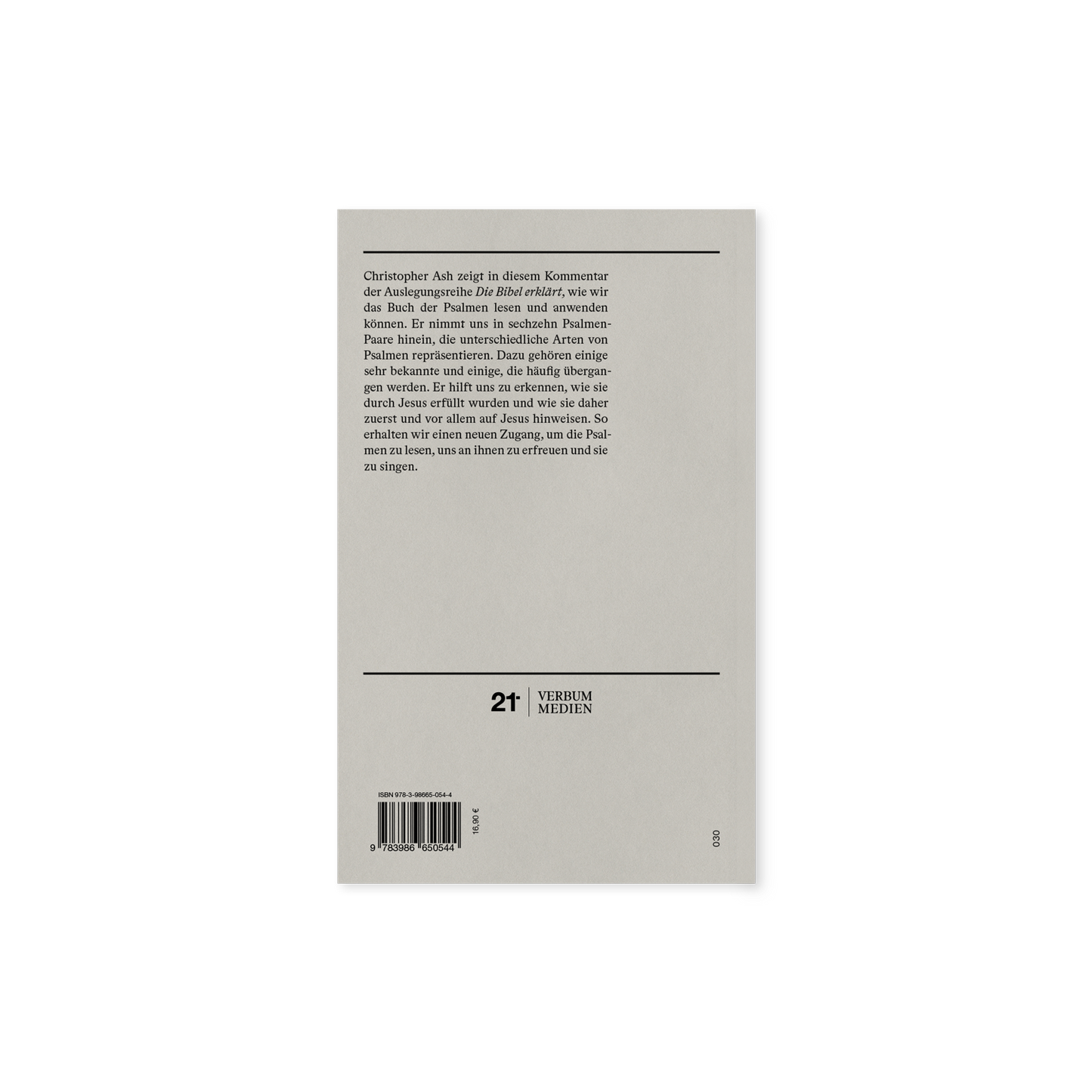Spürst du manchmal eine Diskrepanz zwischen dem, was wir in der Gemeinde singen, und der rauen Realität der Welt da draußen oder vielleicht auch deinem eigenen Leben? Wenn dir das noch nie aufgefallen ist, wird es wahrscheinlich Zeit, denn die Diskrepanz besteht tatsächlich. Möglicherweise nimmt diese Dissonanz sogar zu, da unsere Kirchen immer mehr an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Wir singen, dass Jesus König über die ganze Welt ist, dass nur in Jesus die von uns benötigte Vergebung zu finden ist, dass Gott durch Jesus eine kaputte Welt retten wird, dass das Gute siegen und dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird, in denen es keine Sünde, kein Leid und nichts Schlechtes mehr gibt. In der wirklichen Welt da draußen erscheinen diese Aussagen jedoch völlig absurd. Sie passen nicht zu den schwachen, gespaltenen, ramponierten Gemeinden, die wir so oft beklagen. Auch unsere persönlichen Umstände erwecken manchmal den Eindruck, dass das Gute wohl eher nicht siegen wird.
Psalm 137 ist ein Lied für die Zeiten, in denen wir uns nicht danach fühlen, jene Lieder zu singen, die wir gern singen wollen. Es ist ein Lied, das von Menschen gesungen wurde, denen nicht nach Singen zumute war.
Babylon damals und heute
Wir wissen nicht, wann Psalm 137 geschrieben und zum ersten Mal gesungen wurde. Er weist aber die Merkmale einer Augen-zeugen-Erinnerung auf – da wusste jemand, was es heißt, als Weggeführter in Babylon zu sein (z. B. 2 Kön 25; Jer 52; Klgl; Dan 1). Schon wenig später bezeichnete »Babylon« mehr als ein historisches Reich. Nach Babylons Fall nannten die alttestamentlichen Verfasser zwei Herrscher des persischen Reiches nach wie vor »König von Babel« (vgl. Esra 5, 13; Neh 13, 6). Es dauerte nicht lange und Babylon wurde zu einem Symbol für die Stadt der Welt – das heißt, für jede Gesellschaft, die feindlich gegen Gott und Gottes Volk eingestellt ist. Diese Symbolik erreicht in Offenbarung 18 ihren Höhepunkt. Bis heute ist sie ein aussagekräftiges Bild geblieben. Beispielsweise schrieb Kenneth Anger 1975 das Buch Hollywood Babylon, in dem er dunkle Geheimnisse Hollywoods enthüllte. Wenn wir also in diesem Psalm »Babylon« oder »Babel« hören, sollten unsere Gedanken nicht beim antiken neubabylonischen Reich stehen bleiben. Es handelt sich um das, was der Apostel Johannes einfach »die Welt« nennt – eine Gesellschaft, die Gott gegenüber feindlich eingestellt ist.
Zwar wird in manchen Bibelausgaben Psalm 137, 1–3 als erster Abschnitt dargestellt, ich werde jedoch die Verse 1–4 als ersten Teil untersuchen. Diese ersten vier Verse sind im Plural formuliert und daher gemeinschaftlich (»wir«). In Vers 5 hören wir dagegen, wie sich eine Einzelstimme zu Wort meldet (»ich«). Wir treffen diese weggeführten Gläubigen am Flussufer. Babylon war für sein Bewässerungsnetz aus Flüssen und Kanälen bekannt; Leslie Allen schreibt von einem »komplexen Kanalsystem, das die südbabylonische Ebene durchzog« (Psalms 101–150, S. 307). Die Verse 1–4 beginnen mit »den Wassern zu Babel« und schließen mit »fremdem Lande«. Wir sind also zweifellos weit weg von zu Hause. Hesekiel hatte einige seiner früheren Visionen an einem solchen Fluss (vgl. Hes 3, 15); Esra versammelte an einem anderen die Rückkehrer aus dem Exil (vgl. Esra 8, 21).
Stell dir die Szene vor: Eine Gruppe von Gläubigen versammelt sich mit ihren Musikinstrumenten am Fluss, vermutlich um zu beten, »ein Lied von Zion« zu singen und einander so in ihrem Glauben an den Bundesgott zu ermutigen. Vielleicht singen sie Psalm 46, in dem Zion an einem Strom liegt und die Verheißung erhält, dass es nicht wanken wird. Vielleicht war es auch Psalm 48, in dem Zions Schönheit gerühmt wird und die Feinde schon beim Anblick seiner Pracht erschrocken fliehen. Auch Psalm 50, 2 könnte dabei gewesen sein, mit der einprägsamen Wendung: »Zion, der Schönheit Vollendung« (SLT). Welche Lieder auch zu ihrem Repertoire gehört haben, es waren sicherlich einige darunter, die die Herrlichkeit Zions gemäß Gottes Zielen feierten.
Der Spott der Welt und das Schweigen der Gläubigen
Dann nähert sich eine Gruppe Babylonier. Sie sehen diese Weggeführten aus Jerusalem, und sie beginnen, sie zu verspotten: »Habt ihr gesungen? Wir konnten den Text nicht richtig verstehen, könntet ihr diese Lieder noch einmal singen?« Es schmerzt so sehr! Wir können uns vorstellen, wie die babylonischen Spötter nachhaken:
»O, ihr wollt nicht singen? Woran kann das bloß liegen?« Die Antwort ist allzu offensichtlich. Wie können die Gläubigen von der Uneinnehmbarkeit Zions singen, wenn es doch zerstört wurde? Von der Herrlichkeit des Gottes Zions, obwohl er entehrt wurde? Von der weltweiten Herrschaft von Zions König, obwohl es keinen mehr gibt? Vom Reichtum Zions, obwohl er vernichtet ist? Nein, die Diskrepanz ist zu groß. Sie hängen ihre Harfen in die Zweige der Bäume und lassen verzweifelt den Kopf hängen.
Die Zionslieder scheinen völlig absurd zu sein – offensichtlich ein Wunschdenken fernab aller Realität. Die Juden selbst griffen die Worte »der Schönheit Vollendung« aus Psalm 50, 2 in den Klageliedern auf: »Ist das die Stadt, von der man sagte, sie sei der Schönheit Vollendung ...?« (Klgl 2, 15 SLT). Nein, sie ist es nicht mehr. Diese Zeiten sind vorbei. Spätere Gläubige wie Simeon und Hanna (vgl. Lk 2, 25–) haben dieses Lied vermutlich gesungen und Schwermut empfunden. Jesus könnte es gesungen und um das Volk Gottes getrauert haben. Seine Jünger hätten es passenderweise an Karfreitag singen können, als der Eine, der die Erfüllung Zions war, am Kreuz vernichtet wurde.
Die Gegenwart der Kirche
So ist es auch heute, denn auch wir sind »Fremdlinge ... in der Zerstreuung« (1 Petr 1, 1). Wir sehen die Realität der Kirche Jesu Christi und es ist ziemlich schwierig, die Herrlichkeit dieser Kirche – wie sie im Wort Gottes verheißen ist – zu besingen, und beharrlich immer weiter zu besingen. Die Versuchung ist groß, unsere Harfen an den Nagel zu hängen, unseren Kopf beschämt hängenzulassen und jeglichen Versuch der Evangeliumsverkündigung aufzugeben. Psalm 137, 1–4 hilft uns, die Tränen dieses Schmerzes zu weinen und die Macht dieser Versuchung zu spüren.