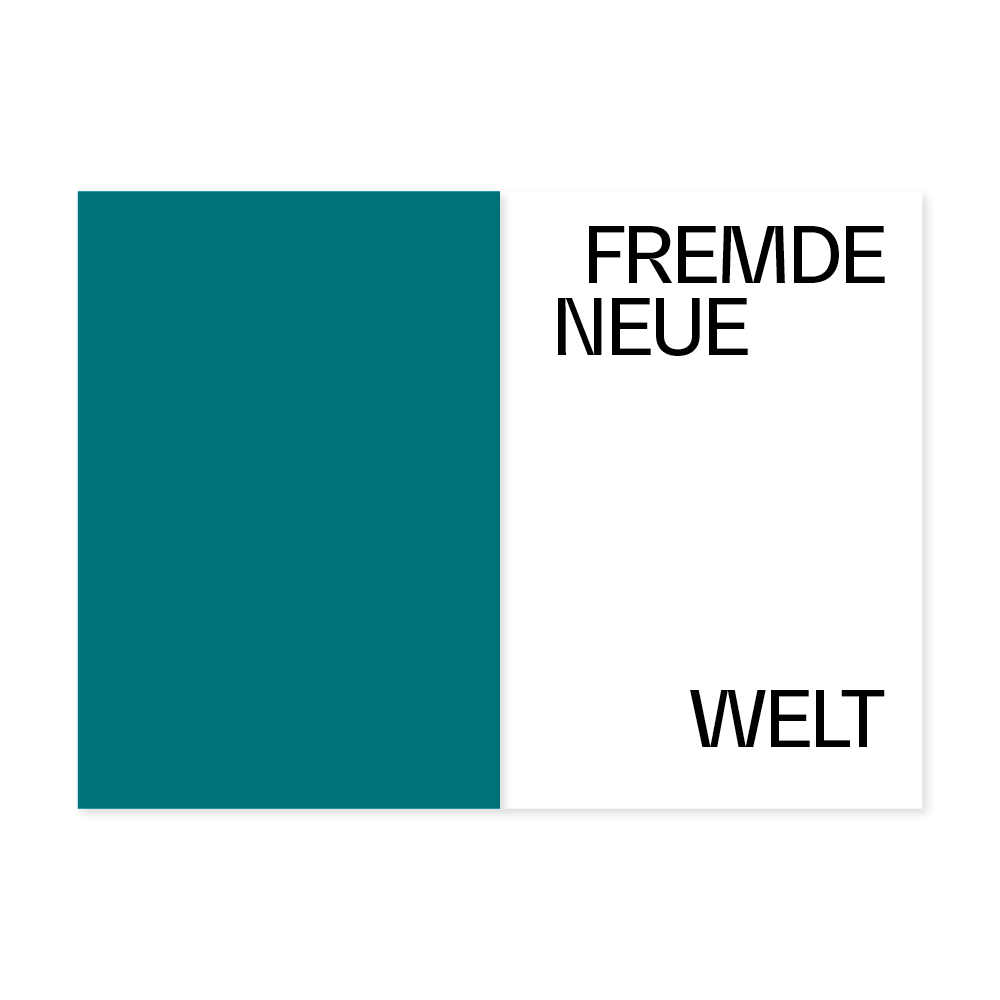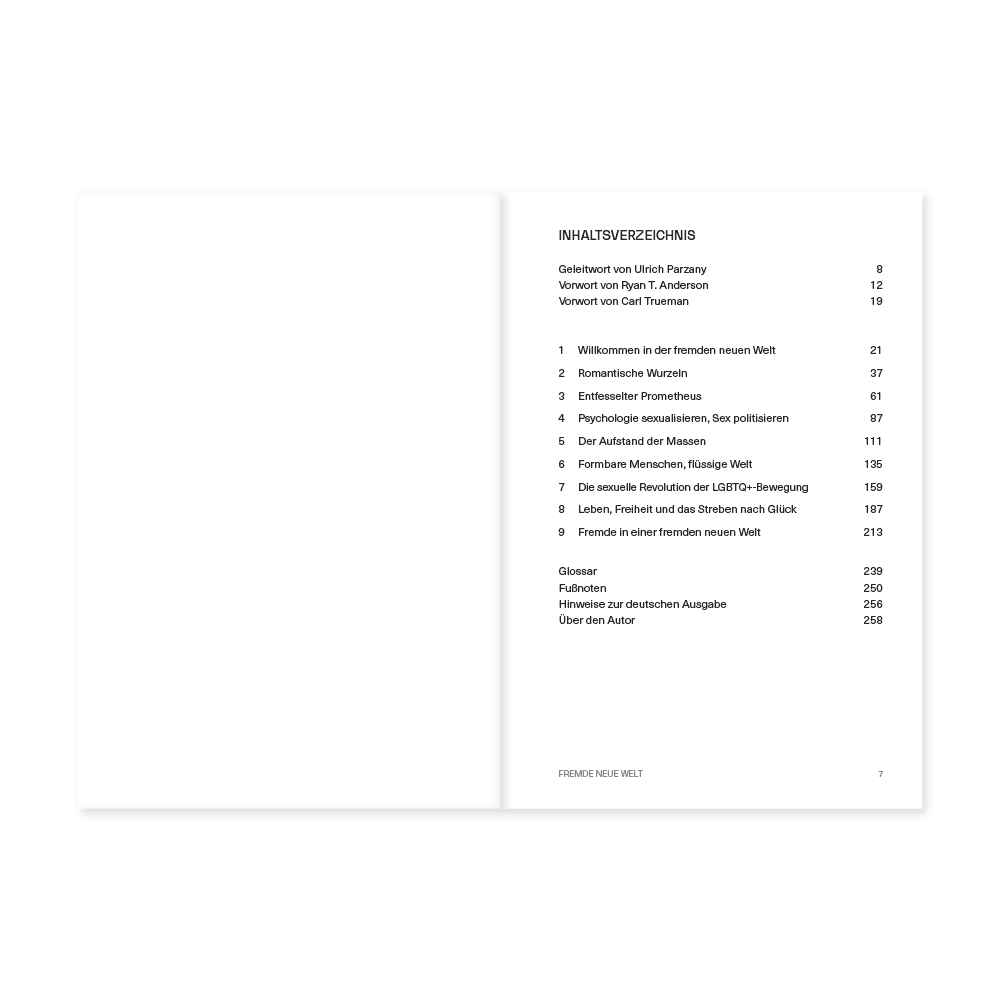Eine nie dagewesene Unsicherheit
Wir leben in einer Zeit, in der die Frage nach der Identität eine instabile, unbeständige und höchst umstrittene Angelegenheit ist, wie sie es so noch nie war. Nun sind übertriebene Kommentare zum Zeitgeschehen als »Krise« und »noch nie dagewesene Zeiten« nicht ungewöhnlich, egal, ob sie von Wissenschaftlern oder Hobbykritikern verfasst worden sind. Das ist normalerweise der Moment, in dem der kundige Historiker ärgerlicherweise ein herablassendes Lächeln aufsetzt und erklärt, dass es so etwas schon früher gegeben hat, vielleicht in Florenz im 14. Jahrhundert oder in Spanien im 16. Jahrhundert oder in Deutschland zwischen den Weltkriegen – und dass wir so etwas doch alles schon einmal gesehen haben. Da ist oft viel Wahres dran, denn wir neigen alle dazu, unsere eigene Zeit und unsere eigenen Probleme als beispiellos und einzigartig herausfordernd anzusehen. Wir müssen daran erinnert werden, dass das in der Regel nicht stimmt. Doch ich meine, dass unsere gegenwärtige Zeit durch das Zusammentreffen von zwei Dingen tatsächlich einzigartig herausfordernd und potenziell unheilvoll ist. Diese zwei Dinge sind die formbare (plastische) Vorstellung der menschlichen Identität, auf die der expressive Individualismus abzielt, und die Auflösung der traditionellen Bezugsrahmen unserer Umwelt (national, religiös, familiär, geographisch, sogar physiologisch), durch die sich Menschen bisher definiert haben. Damit befinden wir uns in einer Situation ohne erkennbare Parallele in der Geschichte.
Was Identität einst stabil machte
In der Vergangenheit – zumindest in den letzten paar hundert Jahren im Westen – gab es im Laufe der Zeit genügend Kontinuität in der Kultur und den Institutionen, um jedem Menschen einen stabilen Rahmen zu bieten, in dem er seine Identität finden konnte. Um noch einmal das Mantra zu wiederholen: Nation, Kirche und Familie waren hier wohl die drei offensichtlichsten Säulen. Als diese im ausgehenden 20. Jahrhundert immer schwächer wurden, bot immerhin unser Körper noch ein Mindestmaß an Kontinuität und Stabilität. Ein Mensch, der mit einem männlichen Körper geboren wurde, musste sich nicht für sein Geschlecht entscheiden. Es war eine Tatsache, auf die er keinen Einfluss hatte. Die Mutter, die eine Tochter zur Welt brachte, wachte nicht zwanzig Jahre später auf und stellte fest, dass ihre Tochter nun ein Sohn war.
Warum wir nicht mehr wissen, wer wir sind
Heute ist das Selbst oder das Ich völlig plastisch und die Außenwelt – bis hin zu unserem Körper – im Fluss, sodass es keinen festen Boden gibt, auf den man seine Identität aufbauen könnte.