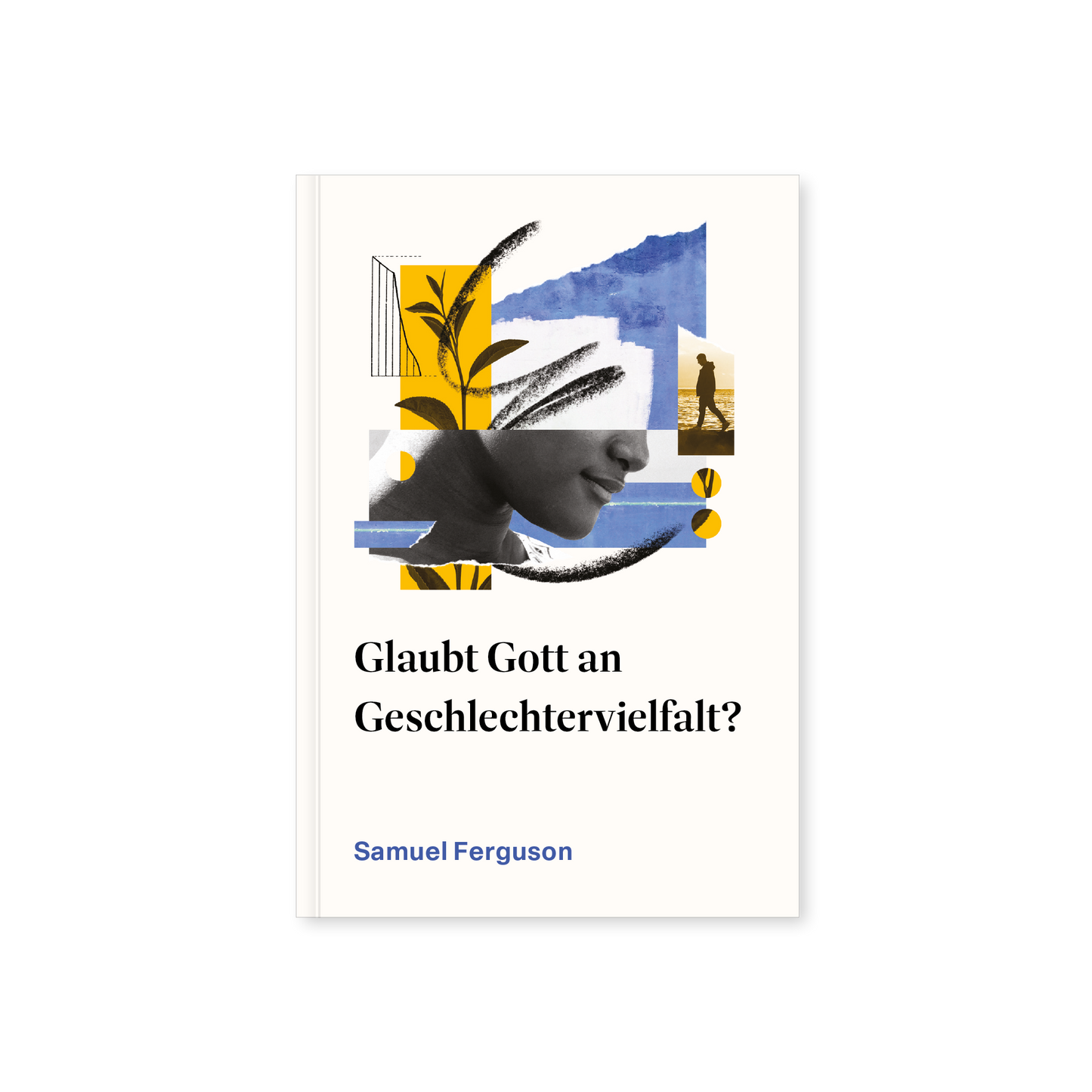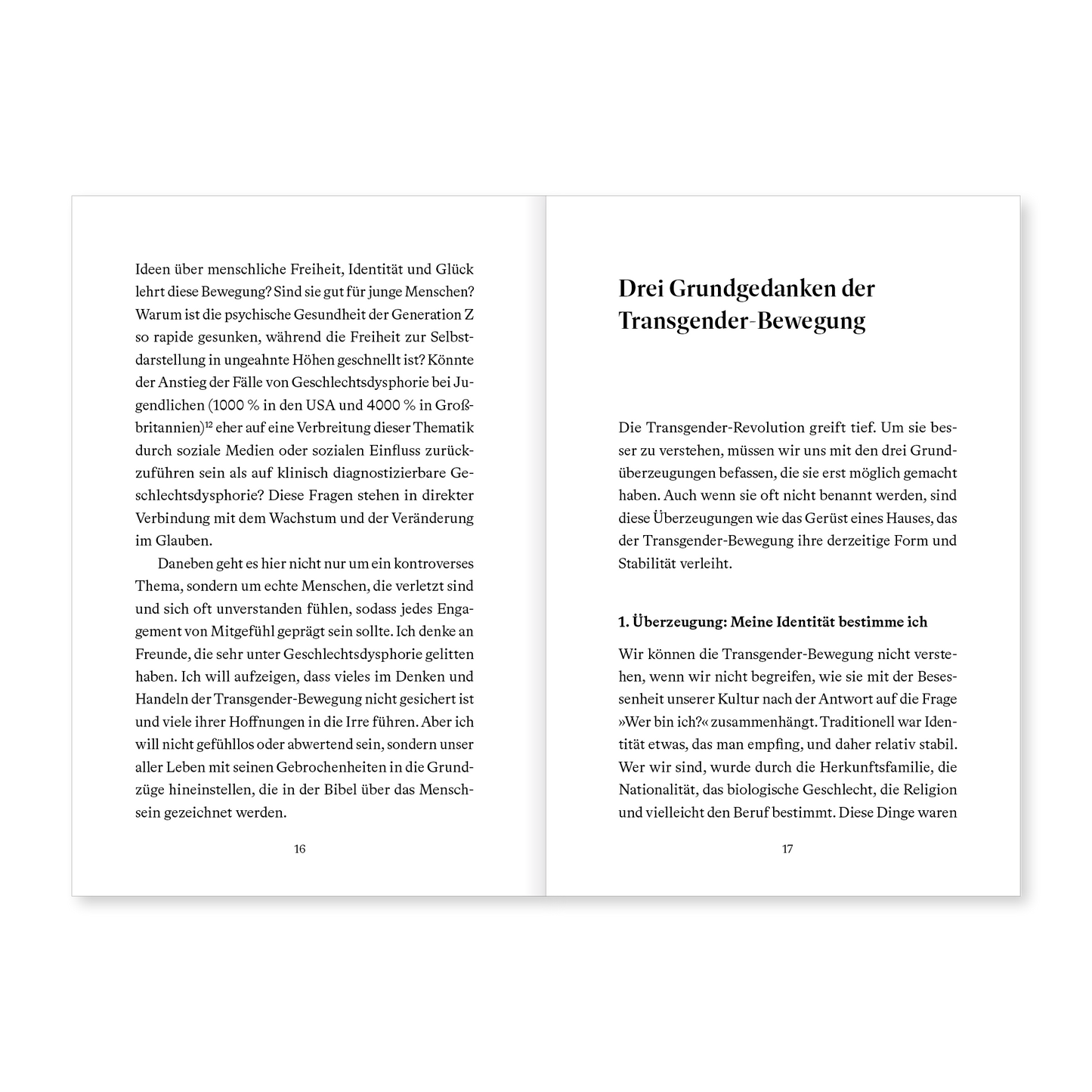In Momenten, wenn unsere eigenen Kinder uns mit LGBTQ-Themen konfrontieren, brauchen wir geistliche Klarheit, eine biblisch gegründete Haltung und Überzeugung sowie einen durchdachten Plan für die Jüngerschaft. Wie sieht das in der Praxis aus? Hier sind drei Tipps für Eltern, die sie im Hinterkopf behalten sollten.
1. Zeige Mitgefühl, wenn sich dein Kind öffnet
Wenn Jesus Kranken, Verwirrten und Erschöpften begegnete, zeigte er Mitgefühl (vgl. Mt 11,28–30; Mk 1,41; 6,34). Das sollten wir auch tun. Die Depressions-, Angst- und Selbstmordraten sind unter Trans-Jugendlichen alarmierend hoch.
»Einem geliebten Menschen in einem solchen Zustand mit Liebe zu begegnen, beginnt mit Zuhören, Empathie und der Anerkennung für den Mut, über das eigene Erleben zu sprechen.«
Was auch immer die Ursachen sein mögen – Menschen mit Geschlechtsdysphorie leiden. Sie fühlen sich vielleicht nicht wohl in ihrer Haut oder werden in der Schule gemobbt. Einem geliebten Menschen in einem solchen Zustand mit Liebe zu begegnen, beginnt mit Zuhören, Empathie und der Anerkennung für den Mut, über das eigene Erleben zu sprechen. Christliche Eltern sollten mit ihrem betroffenen Kind beten und ihm helfen, Jesus in seine Situation einzuladen.
2. Frag nach, was sonst noch los ist
Für Jugendliche stellt sich die Frage nach dem Geschlecht nicht in einem Vakuum. Die Teenagerjahre waren schon immer schwierig. Neben dem Druck, der mit der typischen Entwicklung von Jugendlichen einhergeht, sehen sich Teenager heute mit dem gesellschaftlichen Druck konfrontiert, in einem digitalen und hypersexualisierten Zeitalter aufzuwachsen, welches besessen von Identität ist. Deshalb sollte man bei der Begleitung eines Jugendlichen (oder Erwachsenen), der sich als trans identifiziert, Begleiterkrankungen wie Ängste oder Depressionen berücksichtigen, bevor man über Transition spricht.
»Für Jugendliche stellt sich die Frage nach dem Geschlecht nicht in einem Vakuum.«
Wie Mark Yarhouse und Julia Sadusky schreiben: »Wir empfehlen fast immer, zuerst parallel auftretende Probleme zu behandeln. Keiner soll schwerwiegende Entscheidungen über Geschlechtsdysphorie aus einem Zustand erheblicher Depression heraus treffen.« Indem du Freunden oder Angehörigen zunächst hilfst, andere Faktoren anzugehen, die sich auf ihre psychische Gesundheit auswirken (Angst oder Depression, Schwierigkeiten mit Gleichaltrigen oder ein negatives Körperbild), kannst du ihnen helfen, sich mit ihrem biologischen Geschlecht wohler zu fühlen.
3. Mach dir keine Sorgen, wenn dein Kind untypische Interessen hat
Eltern von Kleinkindern sollten nicht denken, dass ihr Sohn oder ihre Tochter mit einer Geschlechtsdysphorie zu kämpfen hat, nur weil das Kind nicht den üblichen Geschlechternormen entspricht. Schließlich sind viele moderne Ideale über Männlichkeit und Weiblichkeit eher kulturelle Stereotypen als biblische Wahrheit.
Vorurteile können beim Heranwachsen unnötige Verwirrung und Druck auf die Kinder ausüben. Die Bibel liefert Grundzüge für das Ausleben der Geschlechtlichkeit – insbesondere in Bezug auf Sex und Ehe –, aber sie sagt weniger über männliche und weibliche Präferenzen aus, als wir vielleicht denken. In der Bibel steht nicht, dass Männer Sport und Autos mögen oder emotionslos sein müssen.
»Viele moderne Ideale über Männlichkeit und Weiblichkeit sind eher kulturelle Stereotypen als biblische Wahrheit.«
Sie sagt auch nicht, dass kleine Mädchen rosa Kleidung tragen und Puppen mögen müssen. Wenn ein Mädchen Karate mag, gut in Mathematik ist und kürzere Haare bevorzugt, heißt das nicht, dass sie ein Junge ist. Wenn ein Junge gern tanzt, künstlerisch begabt ist und sich die Haare wachsen lässt, ist er trotzdem kein Mädchen. Leider wird Geschlechtsdysphorie manchmal dadurch verursacht oder verstärkt, dass Menschen sich oder andere anhand von Zerrbildern bewerten. Kenneth J. Zucker weist darauf hin, dass manches Leiden, das mit Geschlechtsdysphorie verbunden wird, nicht unbedingt ein Krankheitsaspekt sein muss, sondern auf gesellschaftliche Ablehnung zurückzuführen ist. Wenn sich ein Junge beispielsweise von Gleichaltrigen abgelehnt fühlt, weil ihm typische Jungenspiele keinen Spaß machen, könnte er dieses Problem als Geschlechtsdysphorie interpretieren.