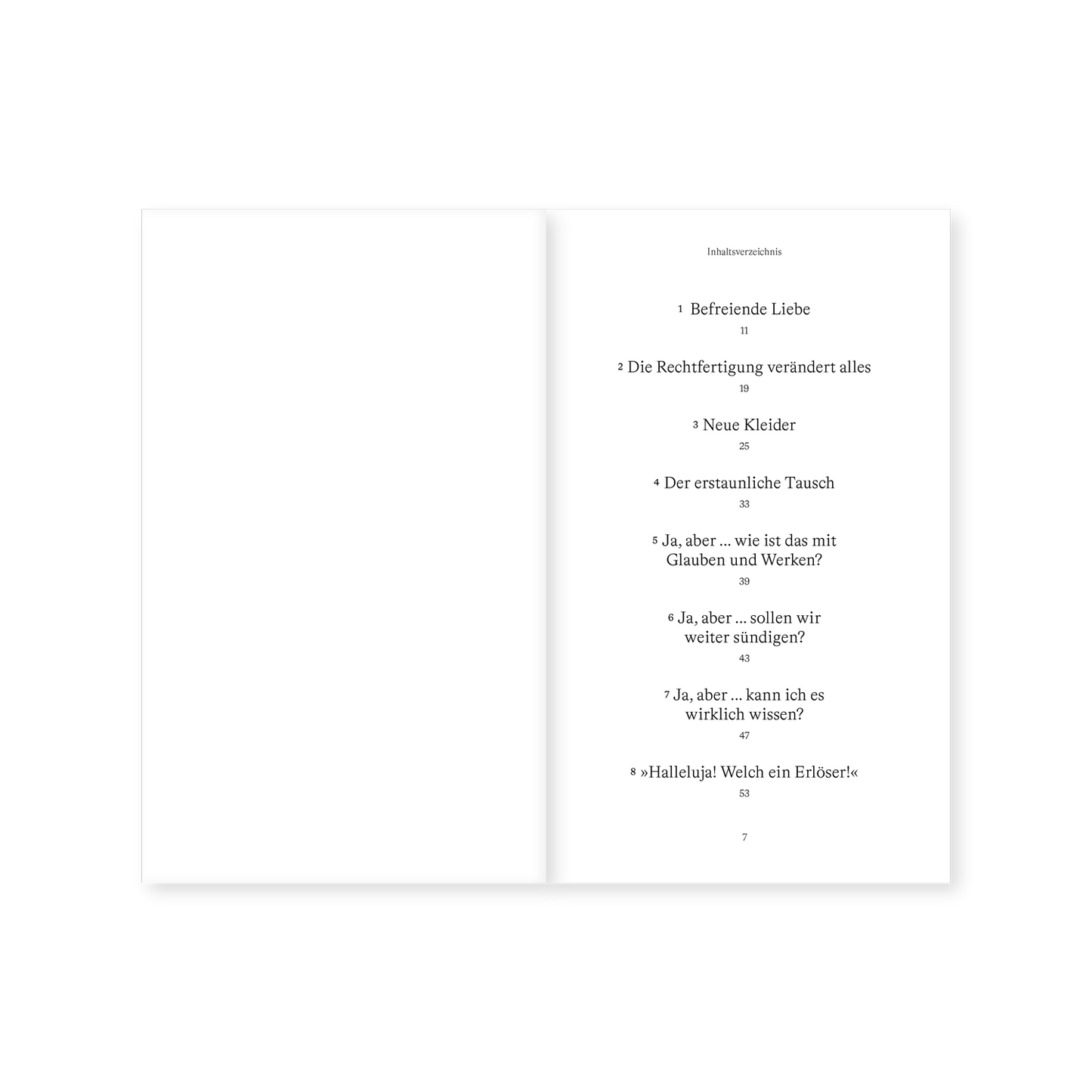Der junge Martin Luther wusste nicht, wie er mit Gott ins Reine kommen sollte. Er fühlte sich deshalb elend. Das war kaum seine eigene Schuld, war er doch in dem Glauben erzogen worden, dass man durch einen Prozess der inneren Besserung mit Gott ins Reine kommt. Das bedeutet: Gott gießt seine Gnade in unser Herz und macht es so Stück für Stück heiliger und himmelstauglicher, Stück für Stück gerechter (oder »gerechtfertigter«).
Diese Lehren zielten eigentlich nicht darauf, ihm Kummer zu bereiten – ganz im Gegenteil! »Dem, der tut, was an ihm liegt, verweigert Gott die Gnade nicht«, säuselte ein Theologe beruhigend. Doch Luther war sich unsicher: Hatte er das Seine getan? War er genügend »gerechtfertigt« oder gebessert, um in den Himmel zu kommen? Was, wenn er plötzlich sterben würde? Wäre er dann gerecht genug für den Himmel?
»Ich will ein Mönch werden«
Luthers Glaube wurde mit einundzwanzig Jahren auf die Probe gestellt, als er zu Fuß unterwegs zu seiner Universität war. Plötzlich zog ein heftiges Unwetter auf und ein Blitz warf ihn zu Boden. Aus Angst vor dem Tod und vor dem, was danach folgen würde, rief er: »Hilf du, heilige Anna, ich will ein Mönch werden!« Er wagte es nicht, zu Gott zu schreien, denn: Würde ein heiliger Gott einen Sünder wie ihn erhören? Daher betete er zur heiligen Anna, der Mutter Marias, in der Hoffnung, sie werde bei Maria ein gutes Wort für ihn einlegen, und Maria werde wiederum bei Jesus ein gutes Wort einlegen.
Nachdem Martin das Unwetter überlebt hatte, begann er ein Leben als Mönch. In gewisser Weise liebte er es. Er hatte größte Angst davor, zu sterben und vor Gott, seinem Richter, zu stehen. Den Eintritt ins Kloster betrachtete er deshalb als einmalige Chance: Er konnte etwas tun, um für Gott annehmbarer zu werden, und so – hoffentlich – Gottes Liebe verdienen.
Also legte er los. Alle paar Stunden verließ er seine winzige Klosterzelle, um am Gottesdienst in der Kapelle teilzunehmen, beginnend mit der nächtlichen Mette, dann um sechs Uhr morgens, um neun, um zwölf und so weiter. Oft nahm er drei Tage lang weder Brot noch Wasser zu sich. Er legte es geradezu darauf an, in der winterlichen Kälte zu erfrieren, in der Hoffnung, Gott zu gefallen. Es trieb ihn in die Beichte. Dort ermüdete er seine Beichtväter, wenn er bis zu sechs Stunden am Stück brauchte, um seine neuesten Sünden aufzuzählen.
»Bin ich gut genug?«
Doch je mehr Luther tat, desto bekümmerter wurde er. War er gewissenhaft genug? Waren seine Beweggründe die richtigen? Luther merkte, wie er in immer tiefgründigere Selbstbetrachtung versank. Er begann zu spüren, dass seine moralische Befleckung und seine mangelnde Gottgefälligkeit tiefer gingen als nur bis zu seinem Verhalten. Er fing an, sich als einen Menschen zu sehen, der in sich selbst verkrümmt und zutiefst selbstsüchtig ist. All sein gutes Handeln und seine religiöse Lebensführung verschleierten das Problem nur, lösten es aber nicht.
Schlimmer noch, der Mönch Luther betrachtete Gott zunehmend als lieblosen Tyrannen, der Vollkommenheit fordert und nichts anderes tut, als zu strafen.
»Wenn ich auch als Mönch untadelig lebte, fühlte ich mich vor Gott doch als Sünder, und mein Gewissen quälte mich sehr. Ich konnte den gerechten, die Sünder strafenden Gott nicht lieben, im Gegenteil, ich haßte ihn sogar … Und wenn ich mich auch nicht in Lästerung gegen Gott empörte, so murrte ich doch heimlich gewaltig gegen ihn.«
In dieser tiefen Finsternis machte er seine glückliche Entdeckung.
»Da fing ich an, zu verstehen«
Luther studierte in seiner Zelle die Bibel. Er rang darum, zu verstehen, was der Apostel Paulus wohl gemeint hatte, als er an die Römer schrieb:
»Denn die Gerechtigkeit Gottes wird in ihm offenbart aus Glauben zum Glauben; wie geschrieben steht: ›Der Gerechte wird aus Glauben leben.‹«
Was bedeutete das? Was genau ist »die Gerechtigkeit Gottes«? Ist gemeint, dass Gott gerecht ist und ich es nicht bin – folglich kann ich keine Gemeinschaft mit ihm haben? Das hatte Luther immer gedacht. Doch es blieb nicht dabei:
»Da fing ich an, die Gerechtigkeit Gottes als eine solche zu verstehen, durch welche der Gerechte als durch Gottes Gabe lebt, nämlich aus dem Glauben.«
»Er hat mich zuerst geliebt«
Diese Erkenntnis veränderte alles. Es war, als würde Luthers gesamte Welt auf den Kopf gestellt. Er begriff: Gott verlangt von uns nicht, seine Liebe und Annahme in irgendeiner Weise zu verdienen. Gottes Gerechtigkeit ist etwas, das er uns schenkt. Man kann Gottes Annahme, Vergebung und Frieden einfach im Glauben – vertrauensvoll – empfangen. Wir müssen uns Gottes Gunst nicht erarbeiten.
Was Luther hier in der Bibel entdeckte, ist eine wahrlich gute Botschaft: ein gütiger und großzügiger Gott, der nicht von den Menschen fordert, ihre eigene Annehmbarkeit zu bewerkstelligen, ehe er sie liebt, sondern der zuerst liebt. Luther verstand, dass er einfach Gottes Zusage annehmen durfte, statt auf sein eigenes Bemühen, gut zu sein, zu vertrauen. An die Stelle all seiner Kämpfe und seiner Angst traten nun frohe Zuversicht und Frieden. Begeistert erzählt Luther:
»Da fühlte ich mich wie ganz und gar neu geboren, und durch offene Tore trat ich in das Paradies selbst ein.«